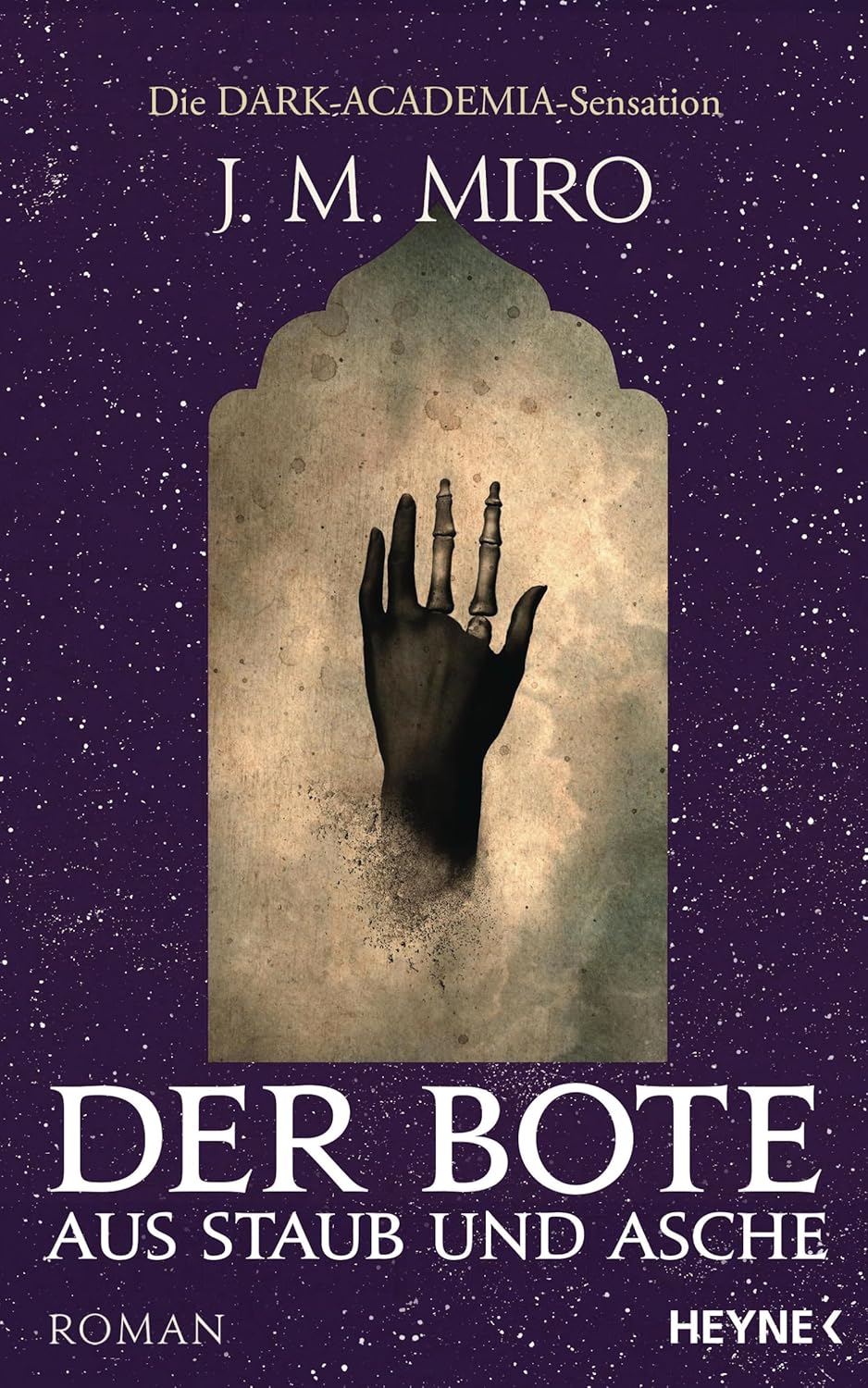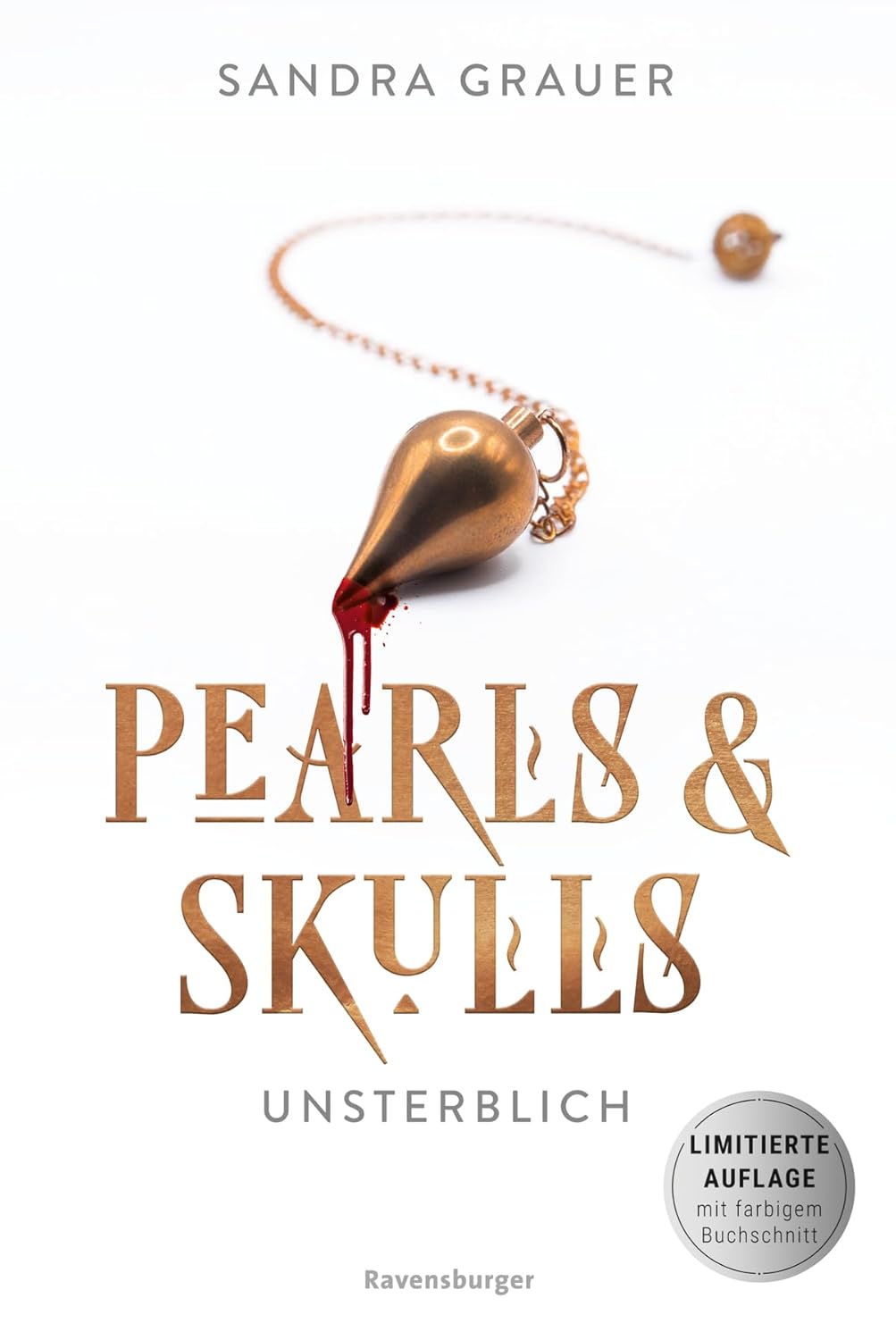- Leseliste
- Vogemerkt
- Rezension
- Gelesen
- Neu
|
2015-08-06 »Die Mechanik der Schändung « - Ein Essay über Fantasy und Gewalt
Das Posting der kritischen Bloggerin Tafkar wurde in den vergangenen Wochen häufig im Internet zitiert und vervielfältigt. Die Verfasserin rechnet darin mit George R.R. Martin und »A Game Of Thrones« ab und präsentiert eine Liste mit allen darin vorkommenden Vergewaltigungen. Martins Gegenargument lautet, er orientiere sich an der europäischen Geschichte und die sei nun mal so.
Geht Fantasy leichtfertig mit dem Thema Gewalt um? Und wie gewaltsam ist vergleichsweise die historische Wirklichkeit? Ales Pickar versucht dieser Frage in einem Essay nachzugehen.
Machen wir uns nichts vor. Zuerst musste Film & Fernsehen kommen, damit Gewalt innerhalb der Phantastik thematisiert wurde. Die eingeschworene »Szene« wäre kaum auf die Idee gekommen, sich selbst anzuzeigen und die Blutlust, die dem Genre seit geraumer Zeit nicht fremd ist, zu hinterfragen. Dieses Gespräch würden wir kaum führen, hätte die internationale Serie »A Game of Thrones« nicht so zahlreiche Anhänger aus non-fantastischen Reihen angezogen. Die Genre-Enthusiasten haben schon lange verstanden, dass das was in Fantasy passiert, auch in Fantasy bleibt. Das Überschwappen brachialer und säbelrasselnder Motive in den Alltag wird nicht befürchtet. Die Fantasy-Fans tragen weder das Faustrecht in die Straßen, noch träumen sie davon, Sansa Stark zu vergewaltigen.  Und doch stehen wir vor einem kulturhistorischen Problem. Fantasy scheint es nun endlich geschafft zu haben, ein Publikum jenseits der üblichen Geek-Zone zu finden. Doch »A Game Of Thrones«, das Produkt, welches die frohe Nachricht in die Welt trägt, strotzt vor Prostitution, Vergewaltigung, Inzest und Meuchelmord. Und so blicken Genre-Außenseiter auf die Fantasy und fragen sich, ob die Schattengewächse schon immer so viel Unflat gelesen haben. Diese Frage ist zum Glück leicht zu beantworten: nein. Denn Gewaltverherrlichung und überzeichnete Sexualität sind im fantastischen Genre eher selten. Nicht unerhört. Aber selten. Zu groß ist die Nähe zur Jugendliteratur, zu tief ist das Kielwasser von Professor Tolkien, der keinen Sinn für Geschmacklosigkeiten hatte. Autoren, die sich von der Atmosphäre der Fantasy angezogen fühlen, bringen selten ein kreatives Bedürfnis nach Massaker und Schändung mit. Ihnen ist nach Edelmut und Romantik. Sogar epische Schlachten präsentieren sich auf eine distanzierte, auktoriale Art und Weise. »Herangezoomt« wird nur kurz, wenn es darum geht, das Scheitern oder das Triumphieren des Protagonisten hervorzuheben. Verglichen mit der erheblichen Anzahl an verhärteten Erotiknovellen, Thrillern und Horror-Romanen, die sich gegenseitig mit ausgeklügelten Mord- und Sexszenarios zu übertrumpfen versuchen, ist somit die Rolle von Gewalt innerhalb der Fantasy verhältnismäßig unbedeutend. In einer stark vereinfachten Erklärung könnte man feststellen, dass am Anbeginn des Genres zwei Titanen gestanden haben - Robert E. Howard und J.R.R. Tolkien. Howards martialischer Conan und Tolkiens feingesichtiger Frodo - sie stellen zwei Prototypen zur Auswahl und wir wissen, für wen sich die meisten Leser entschieden hatten. Das große Schisma zwischen High und Low Fantasy war damit angebrochen. In »Der Herr der Ringe« mangelt es nicht an Schlachten und ihren Opfern - doch sie sind dezent in einen behaglichen Tonfall gehüllt und verlieren dadurch ihren Schrecken. Sie sind da, um den Edelmut der Helden zu belegen, nicht um uns verwirren und von der Menschheit angewidert zurückzulassen. Diese Art von Pietät begleitet Fantasy seit Jahrzehnten, denn das Genre ist zu einem nicht geringen Anteil auch Jugendliteratur.  Conan der Barbarenfaschist - oder ein Mann ohne Eigenschaften?Gewalt ist in Fantasy-Romanen kein neues Thema. Robert E. Howards »Conan der Cimmerier« wütete bereits in den 30er Jahren über die Heftseiten und brandschatzte ganze Dörfer. Howard hatte seine Conan-Romane in einer fiktiven Zeitepoche angesiedelt, die ungefähr 10.000 Jahre vor unserer Gegenwart liegt und die er das »Hyborische Zeitalter« nennt. Doch Fantasy hat oft eine mehr oder minder heimliche Blaupause in unserer eigenen Geschichtsschreibung. Conans Abenteuer orientieren sich an einer Weltordnung, die wir heute die »Völkerwanderung« nennen. Es ist jene ereignisreiche Zeit, die um 370 durch den Sturm der Hunnen gegen den Westen eröffnet wird und 451 n. Chr. mit der Völkerschlacht auf den Katalaunischen Feldern ihren Höhepunkt findet. Diese Ära wird heute gerne mit dem verschwommenen Begriff »das dunkle Zeitalter« (englisch: »Dark Ages«) versehen, was sicherlich ungerecht ist, denn der Alltag im 7. Jahrhundert war sicherlich nicht scheußlicher, als der Alltag im 12. Jahrhundert. Die polnische Professorin und Archäologin Magdalena Mączyńska schreibt: »Die Geschichte und Archäologie weiß zwar viel über die Völkerwanderungszeit, doch gibt es manche Lücke, die vielleicht nie ganz gefüllt werden kann. Es ist, als ob wir uns in einem dunklen Raum befänden, in dem eine Kerze hier und dort eine Ecke beleuchtet, alles andere bleibt im Schatten.« Es sind natürlich diese Lücken, die einen belletristischen Autor animieren, sie zu füllen. Das mag den soliden Historiker in derselben Weise irritieren, wie ein Film über Monsterspinnen aus dem Weltraum einem Arachnologen auf den Keks geht, doch damit werden die Akademiker leben müssen. Wir werden uns immer Geschichten ausdenken, die wir weitererzählen. Es ist die unmittelbare Fortsetzung unserer frühen Erfahrungen mit Märchen und die stille Weigerung, sich nahtlos dem sogenannten Ernst des Lebens zu stellen. Howards Protagonist Conan ist ein Kind seiner Zeit. Er ist ungebildet, hat ein einfaches Gemüt und verfügt doch über eine brauchbare Schläue. Seine Vorzüge sind martialischer Art, Moral ist ihm unbekannt. Ein Sachverhalt, der in den späteren Jahren immer wieder für Irritationen sorgte. In der großartigen Verfilmung von John Milius findet sich der erste Versuch, Conans Persönlichkeit zu erklären. Es ist die Knute der Sklaventreiber und das Aufwachsen des Knaben in Ketten an einem Drehrad (»Wheel of Pain«), das ihn zu dem amoralischen Krieger macht, den wir kennen. In Marcus Nispels Verfilmung von 2011 geht man noch einen Schritt weiter. Conan wird auf dem Schlachtfeld geboren, während seine sterbende Mutter mit dem Schwert einen Kaiserschnitt vollführt. Starke, aber auch befremdliche Bilder, die Robert E. Howard gänzlich abgelehnt hätte. Nicht zuletzt mit der Begründung, dass Conan keine traumatische Kindheit braucht, um so zu sein, wie er ist. Conan ist kein amoralischer Sonderling, während er über die Steppe wandert. Er ist das Spiegelbild seiner (fiktiven) Zeit. Man muss sein rohes Gemüt und seine Frauenfeindlichkeit nicht durch schlechten Einfluss und eine schwere Kindheit begründen, um ihm deshalb einen ethisch bekömmlicheren Anstrich zu geben.  Die Sünden der VäterEs wäre an der Zeit, zu erkennen, dass unsere gesamte Zivilisation auf einem Podest aus Gewalt, Vergewaltigung und Mord steht. Unser Dasein fußt nicht auf der Aufklärung, sondern auf der Unterdrückung. Die Aufklärung ist jener freiheitlicher Schlag, der die Tore zu einem neuen Gesellschaftsvertrag aufgestoßen hatte. Der Geist der Aufklärung bot uns ein neues Weltbild und die Erkenntnis, dass es möglich sein kann, ein Gemeinwesen zu erschaffen, in dem nicht nur Vernunft herrscht, sondern auch Frauen nach Sonnenuntergang vor die Haustür gehen dürfen, ohne missbraucht zu werden. In unserer kollektiven Betretenheit haben wir es ausgeblendet und verdrängt. Irgendwo tief in unserem Inneren verstehen wir, dass Caligula, Nero, Vlad Țepeș, Ivan der Schreckliche und Pol Pot alle nur die Champions einer historischen Wirklichkeit sind, die an jeder beliebigen Stelle tausendmal düsterer war, als wir es allgemein annehmen möchten. Insbesondere für eine Frau. Bei näherem Hinsehen erkennen wir, dass beinahe jeder Feudalherr, der die bedingungslose Macht über tausende Leben in seiner Handfläche gespürt hatte, sich bereitwillig den Exzessen aus Gewalt und Unterdrückung hingab. Es sind nicht die Caligulas und Borgias, die eine erschreckende Ausnahme zur Regel bilden. Sie reflektieren durchaus die Norm ihrer Zeit und erfüllten mit ihren Abscheulichkeiten die Erwartungen der jeweiligen Bevölkerung. Nicht sie waren die Ausnahme, sondern die milden, nachdenklichen Herrscherphilosophen wie Marcus Aurelius oder Friedrich II von Hohenstaufen, die in ihrer eigenen Zeit nicht selten als große Exoten galten. In unserer Bewertung der Vergangenheit ist es dieser häufige Mangel an universell positiven Entscheidern und Gestaltern, der uns unentwegt dazu zwingt, die Geschichte zu glätten und Massenmörder wie Christoph Columbus und Richard Löwenherz zu glorifizieren. Oder Chris Kyle. Wir erfahren die Vergangenheit als ein flüchtiges, verwackeltes Ereignis im Rückspiegel eines Autos. Wir finden gar nicht die Zeit, die Erkenntnisse der Vergangenheit auf uns und unsere Zukunft anzuwenden. In der hastigen Auswertung unserer Geschichte blenden wir all jenes aus, das uns verdächtig erscheint und das unsere eigene Gloriole, als die Krönung der kosmischen Schöpfung, ankratzen könnte. Und dafür mag es zahlreiche Gründe geben, die nicht ausschließlich der Ignoranz oder der Leugnung zuzuschreiben sind. Denn unsere Väter haben uns nichts von diesen Dingen erzählt, so wie ihre Väter ihnen nichts von diesen Dingen erzählt haben.  Historie ist zuallererst etwas, das Erwachsene kleinen Kindern beibringen. Zumeist in Form von Märchen. Es erscheint nachvollziehbar, dass eine feudale und aristokratische Vergangenheit hier in einem milden Licht ihre Schilderung findet. Man beginnt die historische Reise eines Kindes kaum mit der Beschreibung vom Blutgericht von Verden, bei dem Karl der Große über viertausend Sachsen hinrichten ließ. Wir erzählen Kindern nicht von der inzestuösen Beziehung, die Anne Boleyn mit ihrem Bruder unterhielt (und für die sie der »not amused« Heinrich VIII 1536 hinrichten ließ). Dabei waren die Märchen einst gar nicht so gefällig. Den gesammelten Geschichten der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm gelang es durchaus, in ihren Allegorien die Misere des menschlichen Daseins zu komprimieren und für das Gemüt eines Kindes verständlich zu machen. Die Brüder Grimm sahen ihre Märchensammlung nicht als einen Gegenstand der Unterhaltung, sondern als ein pädagogisches Instrument zur Vermittlung eines gewissen Weltverständnisses, mit all seinen Gefahren und Tücken. Dieses Detail ist mehr als nur eine philologische Kuriosität. Das sieht man daran, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in jenen deutschen Besatzungszonen, die von den West-Alliierten kontrolliert wurden, die Ansicht geprägt wurde, grimmsche Märchen trügen eine Mitschuld an den Verbrechen der Nazis. Hierzu wurde 1947 sogar eine Analyse mit dem Titel »First steps in cruelty« präsentiert, die belegte, dass Märchenbücher bei deutschen Kindern zu einer unbewussten Neigung zur Grausamkeit beigetragen hatten. Tatsächlich wurden für viele Jahre die Grimms in Deutschland geächtet und durften nicht nachgedruckt werden. Erst in den 70ern meldeten sich Pädagogen zu Wort und machten sich für deutsche Märchen stark. Doch der Schonwaschgang war nicht mehr aufzuhalten. Gerade im 20. Jahrhundert – also in jenem historischen Abschnitt, der wie kein anderer von realer Gewalt und kataklysmischer Vernichtung durchdrungen ist – wurden die lebensnahen Märchen durch bunte Bilder weichgespült. Aus märchenlesenden Kindern wurden Sammler von überteuertem Merchandise. Und nirgendwo wird dieser Kitsch besser verkörpert, als im modernen Nachfolger des Weihnachtsmanns, dem leicht pädophilen, nach Alkohol und Bahnhofsmission riechenden »Santa Claus«, dessen kometenhaften Aufstieg im vergangenen Jahrhundert die Firma Coca Cola Schritt für Schritt begleitet hatte. In unserer gesteigerten Empfindsamkeit sind wir eine Kinderzivilisation geworden, die weder ein echtes Gespür für die Schrecken der eigenen Herkunft hat, noch ein Verständnis für die Konsequenzen unserer zukünftigen Handlungen. Hierbei muss man an sich heranlassen, dass wir in einer einzigartigen und doch befremdlichen Welt leben. Auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs ist eine neue Welt entstanden. Der tiefsitzende Schock motivierte Millionen zum Aufbau eines neuen Zeitalters. Doch die Welt, die unsere Eltern geschaffen haben, ist eine gespaltene Welt. Die eine Hälfte dieser modernen Schöpfung würde Conan oder den Menschen aus Westeros wie eine Art Paradies erscheinen. Es ist eine Zone, in der stets warmes Wasser aus dem Wasserhahn kommt und wo die Essensmärkte immer vor Nahrung überquellen. Doch diese Welt funktioniert nur deshalb, weil sie relativ klein ist, verglichen mit der »anderen Welt«. In dieser anderen Welt sieht das Leben ganz anders aus. Die Menschen dort hungern und leiden an Krankheiten und nicht selten darben sie unter der Knute ihrer Anführer, die wiederum untereinander um regionale Vorherrschaft kämpfen. Mit dieser Welt könnte sich Conan, wie auch das Haus Lannister, deutlich besser identifizieren. Wir alle sind nun das »Rom« der modernen Ära. Wir haben die stärksten Truppen und das meiste Geld. Und Anführer, die dafür sorgen, dass der Krieg im Ausland bleibt.  Das Unheil als VorstellungDas Leben in Unversehrtheit verlangt unentwegt nach einem Ausgleich. Dies scheint die innerste Natur des Menschen zu sein. Kinder, die in der Geborgenheit ihrer Familien leben, lieben es, sich zu fürchten. Sie benutzen ihre (noch) ungebrochene Fantasie und denken sich Monster und Drachen unter ihrem Bett aus. Die Faszination für das, was man nicht unmittelbar erfahren will, wird ein Thema sein, das sie in unzähligen Facetten ihr gesamtes Leben begleiten wird. George Groddeck hatte bereits vor hundert Jahren festgestellt, dass gerade in einer friedlichen Gesellschaft, in der die Menschen Jahre ohne Unbill erleben, die Anzahl der Mädchen, die sich heimlich ausmalen, ein fremder Mann würde sie in ihrem Schlafzimmer überfallen, deutlich zunehmen. Und gibt man einem Jungen zwei Holzstöcke, einen kurz und einen lang, und dazu ein Stück Seil, ist die Chance sehr groß, dass er sich daraus sein erstes Holzschwert baut. Mit Klinge, Griff und Parierstange. Die meisten von uns haben ihre Kindheit mit gewaltsamen Spielen verbracht. Wir haben König Artus und seine Tafelrunde imitiert, oder Robin Hood. Oder die Rote Armee bei ihrem Vorrücken auf Berlin. Und kein Spiel ist so häufig aufgeführt worden, wie die unvergleichlichen Massaker an der nordamerikanischen Urbevölkerung. Je befriedeter eine Zivilisation ist, um so mehr Sadomasochisten findet man in ihr. Männer, die in ihren Kellern Folterkammern bauen und Frauen, die sich zwanglos in Allegorien der Unterwerfung und Bestrafung begeben. Wir müssen gar nicht die pseudo-literarische und anti-feministische Schmonzette von »E.L. James« bemühen, um diesen Standpunkt unter Beweis zu stellen. In diesen Vorgängen findet auch ein Bannen des realen Schreckens statt. Wir verweisen die Gewalt und die Unterdrückung in das Spielerische. Wir haben Schwerter und Säbel auf die Buchseiten und auf die Leinwand verbannt. Doch das befreit uns nicht von der Erkenntnis, dass unter der Milchhaut noch alle Voraussetzungen der Abscheulichkeit ruhen. Nicht zu töten, ist eine humane Entscheidung und ein Ausdruck von kollektiver Reife. Doch es ist keine gottgegebene Eigenschaft, auf die wir uns sorglos verlassen können.  Die Schändung und ihre Rolle in unserer GeschichteIst nun »Das Lied von Eis und Feuer« ein hypersexueller, gewaltverherrlichender Schund? Diese Frage kann ich hier nicht beantworten. Denn die Schlussfolgerungen liegen gänzlich im Auge eines jeden Lesers. Die Buchreihe ist angesichts reifer Sprache und ausgefeilter Charaktere alles andere als ein Schundroman. Doch es bleibt offen, ob das vergleichsweise häufige Auftreten der sexuellen Gewalt unbedingt notwendig ist, um die Ideen des Werks zu vermitteln. Würden die Romane ebenso gut funktionieren mit einer deutlich geringeren Präsenz all jener zwischenmenschlichen Abscheulichkeiten? Diese Fragen sind legitim. Doch man sollte auch mal kurz die Lanze für George R.R. Martin brechen. Es ist schließlich Fantasy. Und hierin erweist sich Martin als ein außerordentlich fähiger »Weltenbauer«. Jene Gewalt gegenüber Frauen, die seine Romane äußern, ist systemisch. Sie ist eine unvermeidliche Konsequenz einer feudalen Gesellschaftsordnung. Nicht nur der feudalen Gesellschaftsordnung bei Martin, sondern einer jeden feudalen Gesellschaft.  So müsste man sich umgekehrt fragen, ob es nicht ein Versäumnis der vergangenen Autoren war, der Fantasy nicht eine etwas herbere Note zu verleihen. Denn ihre Bücher haben häufig eins gemeinsam: An der Basis ihrer Geschichten steht der Feudalismus. Ein Gemeinwesen, das streng hierarchisch organisiert ist und in dem der Adel über dem gemeinen Volk herrscht. Man kann den Spieß also auch umdrehen und sich fragen: Wenn so viele Autoren einst aufgebrochen waren, um eine feudale Fantasy-Welt zu schildern, weshalb sind so viele in einer verklärten, süßlichen Welt aus edlen Elfen, lustigen Zwergen und profillosen Magiertöchtern angekommen? George R.R. Martin reißt dieser Heuchelei die Maske herunter. Wo ein Thron ist, dort ist Gewalt. Es gibt keinen feinfühligen Feudalismus. Es gibt nur unmittelbare Machtausübung und den täglichen Überlebenskampf. Und die Vergewaltigung war schon immer ein integraler Part dieser Gesellschaftsform. Fantasy hatte viele Jahrzehnte einen blinden Fleck auf der Netzhaut besessen, wenn es um die Aufarbeitung unserer eigenen Herkunft ging. Das Genre war viele Jahre dem Ideal verschrieben, nicht den menschlichen Abgründen. Und so ist die von Bloggern ins Leben gerufene Debatte über übermäßige Gewalt in »Das Lied von Eis und Feuer« für Fantasyleser eine durchaus gesunde Erfahrung. Denn Fantasy wurde in der Vergangenheit selten Thema solcher Diskurse. Zu sehr haftete dem aus dem Groschenroman stammenden Genre der Hauch der Nische an. Und was man nicht ausreichend ernst genommen hatte, wurde auch nicht auf den Prüfstand gestellt. Doch die Zeit der Boris-Vallejo-Covermotive ist vorbei. Fantasy ist tief im Mainstream angekommen. Dass die erfolgreiche TV-Serie geradezu zwanghaft viel Sex aufbietet, ist keine neue Feststellung. Für jene, die dessen überdrüssig sind, stellen diese Szenen zumindest ein Zeitfenster dar, um Tee zu kochen oder auf die Toilette zu gehen. Doch die Bloggerin Tafkar trat im Mai 2015 durch die detaillierte Aufzählung der Vergewaltigungen in »Das Lied von Eis und Feuer« eine Cyber-Lawine los. Die feministische Geek-Plattform »The Mary Sue« hatte nur wenige Tage später angekündigt, »A Game Of Thrones« nicht mehr zu promoten oder zu besprechen. Die literarische Kritik, die Tafkars häufig zitierter und im Internet geteilter Text an G.R.R. Martin übt, betrifft die erzählerische Perspektive der Buchreihe und die betonte Ich-Perspektive der Täter, im Kontrast zu der vernachlässigten Perspektive der Opfer. Tafkar schreibt in ihrem Aufsatz: »Die Geschichten der Vergewaltiger sind George R.R. Martin wichtig. Dies sind die Geschichten, die er erzählt. Unser Blickwinkel liegt bei den Vergewaltigern, nicht bei den Opfern. Die Opfer der Vergewaltigung sind in George R.R. Martins Augen nicht bedeutend genug, um erzählt zu werden, außer sie selbst haben abscheuliche und schurkische Dinge getan. Wenn die Opfer einer Vergewaltigung nicht wichtig genug sind, um eine eigene Erzählperspektive zu haben, und wenn Frauen, die Rache an ihren Vergewaltigern nehmen, die Schurken einer Geschichte sind, wie soll dann eine Leserin, die Opfer einer Vergewaltigung gewesen ist, über ihre eigene Situation befinden, über ihre eigene Suche nach Gerechtigkeit?« Das ist ein literarischer Kritikpunkt, dem sich ein Autor, der dieses etwas empfindliche Minenfeld betritt, durchaus stellen muss. Wer die breite, ausgetretene Straße der Wellness-Literatur verlässt und von den schattigen Abgründen berichtet, muss natürlich mit der emotionalen Betroffenheit rechnen, die seine Schilderungen auslösen. Doch Schriftsteller haben meistens kein Problem mit etwas Schelte. Es beweist ihnen nur, dass sie gelesen werden. Doch der Denkfehler in Tafkars Einwand liegt in der weltfremden Annahme, die Vergewaltigung sei ein exotisches Ereignis, das so selten und damit so verstörend ist, dass ein Autor hier tiefer in die Welt der Traumata graben sollte, um dem Schrecken der Tat gerecht zu werden. Nun, das ist ein Blickwinkel, der uns eigen ist. Und »wir«, das sind jene wenigen Menschen, die räumlich und zeitlich in einer der privilegierten Zonen leben, in denen Vergewaltigung nicht an der Tagesordnung ist. Für die Menschen von Westeros und den Rest der Menschheit gilt dies leider nicht. Martins Protagonistinnen, die mit der Erfahrung der Vergewaltigung robuster und unaufgeregter umgehen, als unser eigenes, deutlich zarteres Gemüt es zulassen möchte, spiegeln damit mehr die historische Frau, die in den vergangenen Jahrtausenden genau diese Art von Übergriff und Missbrauch durch Männer ertragen hatte. Danach musste das Leben weitergehen. Es gab keine Therapeuten und schon gar nicht eine öffentliche Debatte. Im nächsten Absatz fährt Tafkar fort: »Viele Menschen argumentieren, dass George R.R. Martin uns nur zeigt, was Geschichte wirklich darstellt. Doch die Handlung spiegelt nicht direkt unsere Geschichte. Obwohl es stimmt, dass die meisten entsetzlichen Ereignisse zu dem einen oder anderen Zeitpunkt unserer Historie stattgefunden haben, benutzt Martin entsetzliche Ereignisse aus einem ganzen Jahrtausend und quetscht sie in eine Story, die rund 2 Jahre umspannt (bis jetzt). Zusätzlich zu dem Rosinenpicken furchtbarer Vorfälle, selektiert er auch noch die sozialen Bausteine in einer Weise, die einer historischen Analyse nicht standhalten.« Diese Behauptung ist in jeder Hinsicht falsch. Natürlich ist »Westeros« ein Mischmasch aus jenen historischen Bausteinen, die Martin für seine Geschichte nützlich gewesen sind. Wir wissen das. Deshalb nennt man dieses Konzept Fantasy. Doch die Idee, die Gräuel unserer Zivilisation sind lediglich vereinzelte, faule Äpfel im Rahmen einer gemäßigten Weltgeschichte, ist grotesk und widerspricht unserem Wissensstand. Tafkar zeigt deutlich, dass sie in genau jener modernen Seifenblase lebt, die unserer Eltern und Großeltern so erfolgreich aufgebaut haben. Sie projiziert von ihrer eigenen Unversehrtheit auf die Geschichte der Menschheit. Doch die wahre Welt ist draußen, jenseits der Seifenblase. Während ich diese Zeilen schreibe, tyrannisieren irgendwo am anderen Ende der Welt gerade Freischärler ein Dorf. Vielleicht töten sie. Vielleicht plündern sie …, doch viel wahrscheinlicher ist, dass sie Frauen vergewaltigen. Gestern war es Ruanda, Sierra Leone und Bosnien. Heute ist es Somalia, Syrien oder West Papua. Der Blick in die Tiefen unserer Geschichte offenbart deutlich größere Abgründe. Hierzu gibt es viel Forschung. Doch die Schlussfolgerungen sind nicht etwas, das in die Schulbücher der jeweiligen Länder eingeht. Allein in den zwölf Jahren des Zweiten Weltkriegs haben mehrere Millionen Vergewaltigungen stattgefunden. Diese Zahl klingt aberwitzig und ist doch nicht aus der Luft geholt. Ich wurde gebeten, sie hier nicht aufzuschlüsseln. Zu betäubend sind die horrenden Zahlen und die damit verbundene Erkenntnis, wie nahe uns der historische Albtraum steht und wie dünn die schützende Seifenblase ist. Doch wer den Mut hat, in diese wenig besprochene Wunde zu blicken, dem kann ich die Arbeiten der Historikerin Birgit Beck ans Herz legen. In meiner Fantasy-Reihe »Kalion« schreibe ich an einer Stelle: »Zuerst hatte es die Frauen getroffen, so wie stets jedes Unglück, das mit dem Schwert angeführt wird, zuerst dem Weib begegnet.« Dies gilt für die Gesamtheit der letzten 5000 Jahre unserer Menschheitsgeschichte. Die ersten und größten Opfer sämtlicher Kriege sind stets die Frauen. An dieser Stelle spielt es keine Rolle, wohin ich mit verschlossenen Augen in die Seiten eines Geschichtslexikons greife, überall offenbart sich die Vergewaltigung als ein Alltagsphänomen. In Friedenszeiten eine Norm und bei Kriegsausbrüchen ein Muss. Nehmen wir zum Beispiel den Dreißigjährigen Krieg. Ein geeignetes Exempel, denn im Gegenteil zu irgendwelchen antiken und orientalischen Unternehmungen liegt der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648) bereits in einer Ära, die uns kulturell relativ nahe ist. Die Alltagsfacetten des barocken Menschen (von seiner Art Brot zu backen, über das Drucken von Zeitungen, dem Musizieren in Kadenzen, bis zu dem Spielen von Tennis) sind uns vertraut. Dies sind bereits Menschen, die so Deutsch sprechen, dass wir sie zum überwiegenden Teil verstehen würden. In einem Glaubenskrieg zwischen dem Katholizismus und dem Protestantismus gehörte die Vergewaltigung in einer solchen Art und Weise zum Alltagsbild, dass ich als recherchierender Verfasser Mühe habe, ohne Unterbrechung hinzublicken. Mochte die Schändung im bürgerlichen Alltag verpönt sein, in den Kriegshandlungen der Armeen war sie es nicht. In dem 1633 begründeten »Theatrum Europaeum« des Matthäus Merian wird gezeigt, wie der Ausdruck »mit stürmender Hand« der Vergewaltigung von Frauen (und hier insbesondere Jungfrauen) ihre Rechtfertigung gab. Ciceros »Inter arma enim silent leges« (»Denn unter den Waffen schweigen die Gesetze«) hallt hier durch die Jahrtausende.  Als am 20. Mai 1631 die Kaiserlichen Truppen (HRR) die Stadt Magdeburg stürmen, heben ihre Feldherren Tilly und Pappenheim jegliche Zurückhaltung auf. Vergewaltigungen werden zum unmittelbaren Lohn der habsburgischen Söldner. Bei ihrem Einzug hat Magdeburg rund 35.000 Einwohner. Bei einer Volkszählung zehn Jahre später leben nur noch 450 Menschen in der Stadt. 20.000 kommen bei der Plünderung um Leben. Tausende fliehen. Die »Magdeburger Hochzeit« (ein Ausdruck, den laut dem »Theatrum Europaeum« Tilly persönlich geprägt haben soll) mag als das schlimmste Massaker des Dreißigjährigen Krieges gelten, doch die darin angewendeten Methoden waren in jenen Jahren alltäglich und fanden in Dörfern und Kleinstädten in ganz Europa statt. Von Lemgo im Norden bis zum Bodensee im Süden – es gab kaum Ortschaften, die nicht ihre vergewaltigten (und häufig schwangeren) Frauen zu beklagen hatten. Wenn die Truppen angerückt kamen, wurden die Vorräte geplündert, die Männer gedemütigt – und die Frauen vergewaltigt. Es wäre verfehlt anzunehmen, dass der zum Alltag geformte Missbrauch von Frauen und Mädchen ausschließlich den Krieg als Vorwand braucht. In seinem Buch »Obszönität und Gewalt« beschreibt Hans Peter Duerr die eher gängigen Vergewaltigungen, die im mittelalterlichen Paris an der Tagesordnung waren. In größeren Städten des 13., 14. und 15. Jahrhunderts galt eine jede Frau als gefährdet, die sich nach Sonnenuntergang auf der Straße aufgehalten hatte. Und obwohl es reichlich Klagen und Anzeigen seitens der betroffenen Frauen gab, kamen die Täter oft frei, da sie vor dem Richter frech argumentiert hatten, das betreffende Opfer mit einer Dirne verwechselt zu haben. Der Einwand, dass keine ehrbare Frau sich zu so später Stunde draußen aufhalten würde, entsprach häufig dem Empfinden des ausschließlich männlichen Gerichts. Das Diskreditieren von Vergewaltigungsopfern als Prostituierte war damals eine geläufige juristische Praxis und ihre Mechanismen hallen bis in die Moderne. In seinem Buch »Dame Venus - Prostitution im Mittelalter« schreibt Jacques Rossiaud von der Universität Lyon: »Damit wird deutlich, daß (...) es sich bei den Vergewaltigungen keineswegs um eine Jagd auf Angehörige von Randgruppen handelte. Doch vom gesellschaftlichen Status und Ansehen her zählen diese Frauen zu den wehrlosesten Gruppen: Dienstmägde, Töchter und Frauen von Tagelöhnern und Arbeitern im Textilgewerbe. (...) Dies kann nicht erstaunen: Vergewaltigungen an Frauen einfacher Herkunft waren leichter, hatten weniger Strafen zur Folge, zogen keine gefährliche Rache an sich und stießen auf geringere Missbilligung oder gar Ächtung durch die Gesellschaft. (...) Das Lebensschicksal einer Frau hing somit nicht zuletzt von der fama publica ab, einem Gemisch aus Klatsch und übler Nachrede.«  Diese Wirklichkeit musste man in den vergangenen Jahrhunderten keiner Frau erklären. Doch in den heute überexponierten historischen Romanen erfährt man von diesen Dingen kaum. Wir sind eine Generation, die das Leben so heil und geborgen erfährt, dass sie beginnt zu glauben, diese Unversehrtheit sei schon immer ein zentraler Bestandteil der menschlichen Psyche gewesen. Eine Denkrichtung, die sehr falsch ist. Eine Denkrichtung, welche die Verdienste der Aufklärung und des Feminismus relativiert und die wahren Schrecken unserer Geschichte verharmlost. Ob »A Game Of Thrones« nun eine Banalisierung dieser alltäglichsten aller Abscheulichkeiten darstellt, oder unseren historischen Kontext in ein wirklichkeitsnäheres Licht rückt, ist eine gesonderte Debatte, die sicherlich noch andauern wird. Doch der Vorwurf, Buchreihe und TV-Serie seien beides bezüglich der sexuellen Gewalt eine übertriebene Verunglimpfung der Antike oder des Mittelalters, ist gänzlich falsch. Quo vadis?All diese Fakten zur sexuellen Gewalt zusammenzutragen, fällt nicht unbedingt leicht. Sie schaffen ein Übergewicht, welches den Text verzerrt. Doch es geschieht mit einer Absicht. Es gilt zu erkennen, dass in einem literarischen Bauwerk, an dessen Basis eine feudale Gesellschaftsform steht, es wesentlich irrealer ist, Geschichten zu spinnen, in denen keine Vergewaltigungen stattfinden. Der Ruchlosigkeit und dem sexuellen Missbrauch in »A Game Of Thrones« kann man nur auf einer Ebene begegnen: der Ebene des Geschmacks. Wer sagt, ihm sei ein solches Format zu gewalttätig, amoralisch und in Gänze unerträglich, handelt in Folge seiner eigenen Empfindung. Dies ist vollkommen legitim und sollte vollste Zustimmung haben. Ebenso sollten kein Autor und kein Filmemacher von der Beurteilung befreit sein, ob die Gewalt in seinen Werken eine aussagekräftige Bedeutungsebene besitzt, oder grundlos und ohne jeglichen Subtext dem Ergötzen des Publikums gilt. Natürlich hat gerade Fantasy das ständige Potential, zur Pornographie abzusinken. Doch zu behaupten, diese Erzählelemente wären eine Verfälschung der gesamthistorischen Leinwand, die in Wirklichkeit halb so schlimm gewesen sei, ist angesichts der Faktenlage einfach nur Wunschdenken und grober Unfug. Wir haben festgestellt, dass verglichen mit der Realität des Gestern und des Heute, die Welt von »Westeros« eher mild und harmlos ist. Es ist noch gar nicht so lange her, da galt die Vergewaltigung fremder Mädchen in fernen Dörfern als einer der zentralen Anreize, weshalb ein junger Mann sich einen Helm aufgesetzt, eine Hellebarde gegriffen und die Schikanen eines Offiziers ertragen hatte. Wenn also jemand dieses Thema literarisch verarbeitet, sollten wir weder zu pikiert sein, noch die Zuflucht in einem weitgehend zensierten und verzerrten Geschichtsbild unserer eigenen Kultur suchen. Natürlich dürfen wir aus all diesen Worten nicht schlussfolgern, dass Fantasy von nun an dazu bestimmt sei, in einem Meer aus Blut zu waten und Frauen wie Dreck zu behandeln. Gute High-Fantasy-Erzählungen sind Vehikel für universelle Wahrheiten. Jene archaischen Muster und tiefenpsychologischen Prozesse, die Joseph Campbell in »Der Heros in tausend Gestalten« beschreibt. Diese Topoi benötigen weder ständige Intrigen noch Massenhinrichtungen und am wenigsten das Vergewaltigen von Burgfräuleins. Und doch ist »Das Lied von Eis und Feuer« nur der erste mürrische Vorbote eines neuen Stils. Der Geist von Robert E. Howard, der in dem frühen Alter von 30 Jahren gestorben war, kehrt zurück und mahnt uns zu raueren Tönen. In Großbritannien ist es Joe Abercrombie, in Deutschland Jordis Lank, Patrick R. Ullrich oder Horus W. Odenthal, die eine neue Fantasy erzählen - mit herben Kanten und manch einem zynischen Blick auf das menschliche Dasein. Die moderne Fantasy ist fortan ein reicheres, umfassenderes Gedankengebäude. Es liegt nun am Leser, sich für Geschichten zu entscheiden, die einen jungschen Mythos heraufbeschwören, bei dem der Sexus mit all seinen Schatten zweitrangig ist, oder für jene Erzählungen, die in schonungsloser Manier und freudscher Gradlinigkeit die menschliche Verfassung festhalten. Die Worte von Ursula K. Le Guin geben eine gute Richtung vor, die ein Fantasy-Autor am Steuerrad seiner Geschichte vor Augen behalten sollte: »(...) Fantasy ist wahr - natürlich ist sie das. Sie mag nicht faktisch sein, aber sie ist wahr. Kinder wissen das. Erwachsene wissen es auch, und genau deshalb fürchten sich so viele von ihnen vor Fantasy.«
A.P. Über den Autor: Ales Pickar
Aleš Pickar arbeitet seit 1998 an seinem »Spiegel«-Universum und erschuf in bisher fünf Bänden die Saga um den Angelodämonischen Krieg. Der beim Vedra-Verlag erschienene Sammelband seiner ersten drei »Spiegel-Romane« (»Die dunkle Stadt«) wurde für den Deutschen Phantastikpreis 2011 nominiert. Aleš Pickar lebt gegenwärtig in Mittelfranken. Sein aktuelles Projekt heißt »Kalion«. Er freut sich über FB-Freundschaftsanfragen und twitterige Verknüpfungen.
FANTASYBUCH.de - Phantastik Fantasy-Bücher Science-Fiction-Romane Film-Trailer und Mehr |
The file test.cache is not writable